Der Gipfel des Irrsinns

Menu


Die schöne Schauspielerin Iris Mareike Steen und ihre Serie GZSZ gibt es seit 30 Jahren – zur Feier zeigt sie uns heiße Ecken ihrer Heimat Hamburg
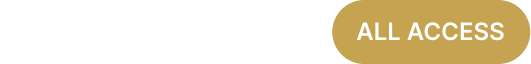
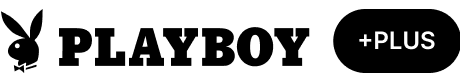
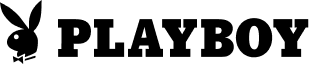
 E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben
E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben 250.000+ exklusive Fotos und Videos
250.000+ exklusive Fotos und Videos Internationale Coverstars und Playmates
Internationale Coverstars und Playmates 70 Jahre Playboy-Geschichte
70 Jahre Playboy-Geschichte 250.000+ exklusive Fotos und Videos
250.000+ exklusive Fotos und Videos Internationale Coverstars und Playmates
Internationale Coverstars und Playmates 70 Jahre Playboy-Geschichte
70 Jahre Playboy-Geschichte inkl. E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben
inkl. E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche
Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben
Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper
Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper Alle Stories auf Playboy.de
Alle Stories auf Playboy.de Alle Stories auf Playboy.de
Alle Stories auf Playboy.de Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper
Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben
Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche
Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche Die Galerie des Tages
Die Galerie des Tages Abstimmung für die Galerie von morgen
Abstimmung für die Galerie von morgenJährlich
20 % SPAREN
1,99 € pro Woche
3,99 € pro Woche
4-wöchentlich
2,49 € pro Woche
4,99 € pro Woche
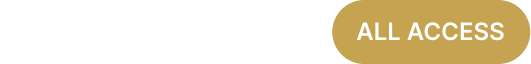
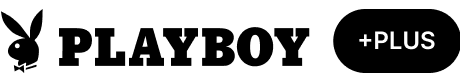
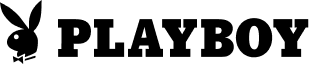
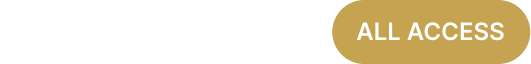
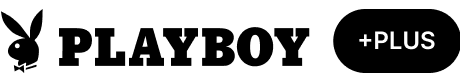
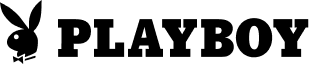
 E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben
E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben 250.000+ exklusive Fotos und Videos
250.000+ exklusive Fotos und Videos Internationale Coverstars und Playmates
Internationale Coverstars und Playmates 70 Jahre Playboy-Geschichte
70 Jahre Playboy-Geschichte 250.000+ exklusive Fotos und Videos
250.000+ exklusive Fotos und Videos Internationale Coverstars und Playmates
Internationale Coverstars und Playmates 70 Jahre Playboy-Geschichte
70 Jahre Playboy-Geschichte inkl. E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben
inkl. E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche
Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben
Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper
Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper Alle Stories auf Playboy.de
Alle Stories auf Playboy.de Alle Stories auf Playboy.de
Alle Stories auf Playboy.de Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper
Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben
Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche
Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche Die Galerie des Tages
Die Galerie des Tages Abstimmung für die Galerie von morgen
Abstimmung für die Galerie von morgenJährlich
20 % SPAREN
1,99 € pro Woche
3,99 € pro Woche
4-wöchentlich
2,49 € pro Woche
4,99 € pro Woche
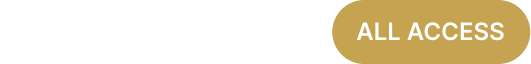
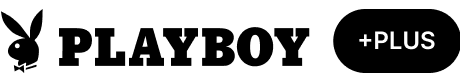
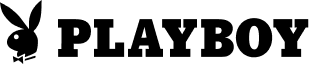
First Lady: Carmen Electra feiert Geburtstag
Ein guter Monat für: Kunstkenner und Liebhaber
20 Fragen an ... Samuel L. Jackson
Playboy-Umfrage des Monats: Was halten die Deutschen von einer Cannabis-Legalisierung?
Männerbar: Jörg Meyer, der Bartender des Jahres, kredenzt seinen Signature Drink
Männerküche: Julia Komp, die Köchin des Jahres, serviert eine köstliche Lammschulter
Wein des Monats: Der kräftige Gewürztraminer
Helge-Timmerberg-Kolumne: Der Zeitgeist und ich
Reise: Mit dem Fahrrad in den Urlaub – und was man dazu alles braucht
Pro & Contra: Weniger arbeiten – eine gute Idee?
Motor: Mit dem Cupra Born durch Barcelona
Stil: Die Sonnenbrillen des Sommers 2022
Die schöne Schauspielerin Iris Mareike Steen und ihre Serie GZSZ gibt es seit 30 Jahren – zur Feier zeigt sie uns heiße Ecken ihrer Heimat Hamburg
Irrsinn am Everest: Wie Touristen in der Todeszone des welthöchsten Berggipfels ihr Leben für absurde Rekorde und Foto-Trophäen riskieren
Jan Frodeno: Der deutsche Triathlon-Champion will mit 40 seinen vierten Ironman-Titel holen und verrät uns, wovor er wegläuft und wie aus Wut Energie wird
Atze Schröder: Der Comedian erklärt den Mann, der wirklich unter der Lockenperücke steckt
Die neue Corvette Stingray: Eine Ausfahrt im ersten Mittelmotor-Modell der legendären Sports-Car-Reihe
50 Jahre Porsche Design: Der Chef Roland Heiler enthüllt zum Jubiläum Geheimnisse guter Gestaltung
Mein Schlitten: Anna Bauer und ihr besonderer Audi
Fahrtraining im Eis: So erlebten Playboy-Leser die Hyundai Winter Experience in Sölden
Männer-Insel: Rückblick auf unser spektakuläres 90 und stürmisches Gentlemen’s Weekend auf Sylt
Playmate: Unsere Miss Mai, Milena Milyaeva aus Kiew, beweist Mut – vor der Kamera und im Leben
Blende Sechs: Spaniens schönste Prominente, das Model Marta López Álamo, lässt die Hüllen fallen
Nette neue Väter: Gehen Männer heute besser als früher mit Frau und Kindern um? Ja, aber noch immer nicht so toll, dass es Applaus verdient
Mode: Die Wiederentdeckung des Hawaii-Hemds
Düfte: Neuheiten für den Mann im Frühling
Tagebuch einer Verführerin: Sophie Andresky warnt vor schlechten Techniken der Onanie
Nicolas Cage: Der Kinostar über seinen neuen Film, in dem er sich selbst spielt, seine Ängste und warum er Hollywood den Rücken gekehrt hat
Literatur, Musik & Serien: Das Beste des Monats
Stephan Keck hat eine Idee. Nächstes Jahr wird er sich mal eine Woche Zeit nehmen und auf den Everest gehen. Mit dem Flieger nach Kathmandu, mit dem Heli ins Basislager auf 5300 Metern, am nächsten Tag hoch zu Lager 2 auf 6400, tags darauf auf den Gipfel und wieder zurück. Das alles in sieben Tagen. Eine normale Expedition dauert zwei bis drei Monate. Spinnt der? Klare Antwort: ja und nein. „Das ist eine Provokation“, sagt Keck. „Ich will zeigen: Das geht, macht aber keinen Sinn.“ Der Trip wäre Kecks Art, in die Welt zu brüllen: Was soll der Wahnsinn?
Stephan Keck, 48, ist Extrembergsteiger. Ein Mann, der das Bergsteigen mit jeder Faser seines so durchtrainierten wie geschundenen Körpers liebt. Er versteht, wie verführerisch Gipfelträume sein können. Er verdient sein Geld damit, sie anderen zu erfüllen. Aber die Auswüchse des Massenandrangs am Everest will er nicht mehr unterstützen.
Einmal am höchsten Punkt der Welt in 8848 Meter Höhe zu stehen, das war schon seit der Erstbesteigung 1953 ein Ziel für abenteuergierige und todesverachtende Extrembergsteiger. Heute ist es längst auch eines für zahlungskräftige Manager, Trophäen-Touristen, Rekordjäger aller Art sowie ambitionierte Hobbybergsteiger mit Instagram-Account. Der Everest-Gipfel ist ein populäres Ziel geworden – und es ist ein großes Geschäft, Menschen hinaufzubringen. Das hat Folgen. Die mangelhafte Akklimatisierung mancher Touristen, die fehlende Prüfung ihrer Everest-Tauglichkeit, ihre ungenügende Betreuung beim Aufstieg und ihre gefährliche Fixierung darauf, den Gipfel zu erreichen, ihr Leichtsinn, ihre Selbstüberschätzung: Oben in der Todeszone kann das lebensgefährliche Konsequenzen haben. Und die hat es auch. Leichen säumten bis vor Kurzem noch den Weg zum Everest-Gipfel: eine knietief ausgetretene Spur mit Fixseilen vom Basislager bis ganz nach oben, die den trügerischen Anschein erweckt, jeder könne sie bewältigen.

Und so werden sich auch im Mai dieses Jahres wieder Hunderte auf den Weg machen, wenn die Everest-Saison ihren Höhepunkt erreicht, weil sich dann die wenige Tage umfassenden Zeitfenster bieten, in denen der Berg sich erklimmen lässt. Sie werden den Khumbu-Eisbruch durchsteigen, dann die Lhotse-Wand und schließlich von Lager 4 aus, dem letzten Rückzugspunkt auf rund 8000 Meter Höhe, den Gipfel in Angriff nehmen. Im Mai 2019 taten das an einem einzigen Tag rund 200 Menschen. Das absurde Bild ging um die Welt: eine Warteschlange wie am Eingang zu einem Rockkonzert – an einem der unwirtlichsten Orte des Planeten. Ein lebensgefährliches Gedränge in der Todeszone. In den vergangenen zwei Jahren wiederholte sich dieses Schauspiel nicht, die Corona-Pandemie brachte den Tourismus am Everest praktisch zum Erliegen. Jetzt aber geht es wieder los. Auch für Keck.
Mit vier Kunden, potenziellen Gipfelstürmern, und sieben Trekkern, die bis zum Basislager mitlaufen, ist er seit Ende März unterwegs zum höchsten aller Berge, auf dem sie Ende Mai stehen wollen. Mit Himex gehört Keck eines der ältesten und angesehensten Unternehmen, die Himalaja-Expeditionen anbieten. Er lebt von dem Geschäft am Berg. Aber so wie bisher will er es in Zukunft nicht weiterbetreiben. Denn: „Da oben läuft etwas verkehrt, und zwar gewaltig. Der Berg ist voll.“
Schon vor zehn Jahren standen an einem Tag 245 Menschen auf dem zwei Quadratmeter kleinen Gipfelplateau – mehr als zwischen 1953 und 1987 insgesamt dort gestanden hatten. Lange war dieses Erlebnis nur einsamen Spitzenprofis vergönnt. Doch dann kamen die Laien: Anfang der 80er-Jahre setzte sich der amerikanische Öl-, Gas- und Kohle-Unternehmer Dick Bass in den Kopf, die höchsten Berge der sieben Kontinente zu besteigen, die Seven Summits. 1985 kletterte er als erster Tourist mit Bergführer auf den Everest – von da an strömten sie in Scharen herbei: Menschen mit Prothesen, Blinde, Hochzeiter, Paraglider, Skifahrer, Snowboarder, 13- und 80-Jährige. Ein 85-Jähriger starb im Basislager, als er einen Altersrekord aufstellen wollte. Ein beidseitig beinamputierter Chinese erstritt sich die Erlaubnis zum Gipfelaufstieg am Obersten Gerichtshof in Nepal: Mit dem Argument, er würde diskriminiert werden, kippte er ein Gesetz, das genau solche Auswüchse verhindern sollte. Das Basislager auf 5300 Metern begann, sich in der Gipfelsaison im Frühjahr in eine über 2,5 Kilometer hingestreckte Kleinstadt mit Hunderten Zelten zu verwandeln. Es gibt Pubs, Kinoleinwände, eine Bäckerei mit Zimtschnecken.
Das Problem ist: Wer das entsprechende Kleingeld hat – 50.000 bis 110.000 Euro kostet eine Everest-Besteigung –, kann den Gipfelbesuch buchen wie einen Strandhotel-Aufenthalt auf Ibiza. Er muss noch nicht einmal sonderlich viel Zeit in die Vorbereitung investieren. Akklimatisierung? Die findet bei wohlhabenden Kunden mittlerweile gern mal daheim im Druckzelt statt. Unter abenteuerlustigen Managern, die glauben, nicht länger als eine Woche abkömmlich sein zu können, ist das längst üblich. „Die Leute haben das Geld, aber nicht die Zeit“, sagt Keck. „Wenn der Manager zwei Wochen ausfällt, hat er mehr Geld verloren, als er mir zahlen muss. Das ist seine Kalkulation. Aber das passt nicht in meine Philosophie.“
Keck weiß: Berge wie dieser sind keine Orte für Blitzbesuche. Sie sind Orte, auf die man sich einlassen muss. Deshalb dauern die Bergabenteuer seiner Kunden länger. Schon Wochen vorher nähern sie sich den riskanten Höhen an, unternehmen kleinere Touren, gewöhnen sich an die Belastung. Sind sie überhaupt everesttauglich? Das findet Keck heraus. Ein pauschales Versprechen, gegen Bezahlung den Gipfel zu erreichen, gibt es bei ihm nicht. Lebendig wieder zurückzukommen ist wichtiger. Das hat er selbst schmerzlich erfahren. Seine Philosophie ist nicht am Schreibtisch entstanden.




Der Ort, in dem er aufwächst, Stans in Tirol, ist umringt von Zwei- bis Dreitausendern. Und Keck ist schon in der Jugend besessen von ihnen. Er absolviert eine Lehre als Installateur – dann wendet er sich seiner Leidenschaft zu. Er lässt sich zum Bergretter ausbilden, wird Bergführer, Ski- und Snowboardlehrer, Paraglider, auch am Balloon-Skiing hat er Spaß: Dabei seilt man sich mit Skiern am Rucksack aus einem Heißluftballon auf einen Gipfel ab. In den Anden besteigt er zig Fünf- und Sechstausender, klettert in den senkrechten Wänden im Yosemite Park, landet im Himalaja und steht 2004 auf seinem ersten Achttausender, dem Shisha Pangma. Keck macht sich einen Namen in der Szene, gewinnt immer mehr Sponsoren. Aber er lernt auch, wie gefährlich es sein kann, aus den falschen Gründen gefährliche Dinge zu tun: „Du wirst selbst gipfelgeil. Und wenn ich 120.000 Euro im Jahr kriege, will ich auch was bieten. Obwohl der Sponsor das gar nicht verlangt.“
So landet er im März 2008 am Everest – zu einer Solo-Tour ohne Sauerstoff und ohne Sherpa, wie die einheimischen Weghelfer heißen, die sich als Gepäckträger verdingen. „Im Basislager hat ein nepalesischer Freund gekocht, den Rest habe ich selbst gemacht – eine kernige Challenge, wenn man noch nie da war“, erinnert sich Keck. Es wird dann auch grenzwertig. Auf 8000 Metern führt bei Keck eine verschleppte Zahnentzündung zu einem Infarkt im Auge. Er kehrt um, steigt ab in Lager 2. Noch reicht seine Kraft. „Es gibt ja so eine Art natürliches Doping“, erklärt er, „der Körper hält immer zehn Prozent Reserven zurück, damit Herz, Lunge und Hirn noch funktionieren.“ Am Abend läuft er auf dem Weg zurück ins Basislager als letzter Bergsteiger durch den Khumbu-Eisbruch. Er beeilt sich, hängt sich nicht mal mehr ins Fixseil ein – und stürzt samt 20-Kilo-Rucksack mehrere Meter tief in eine Spalte. Keck hat Glück, landet auf einer Schneebrücke, „sonst wäre es noch weiter runtergegangen“. Zwei Stunden braucht er, bis er wieder raus ist, und weil er sich am Knie verletzt hat, weitere acht statt der üblichen anderthalb Stunden ins Basislager. „Da habe ich beschlossen: No more Sponsoring. Lieber nicht so weit gehen, dass ich nicht mehr zurückkomme. Dafür waren mir mein Leben und die Familie zu wichtig.“
Acht Bergführer gab es in Kecks Ausbildung, die sich auf Höhenbergsteigen spezialisiert haben – heute leben noch zwei. Keck hat das Umkehren gelernt: „Das ist ein größerer Erfolg als oben stehen“, sagt er. Einige zahlende Kunden am Everest sehen das anders. Sie sind nur für den Gipfel gekommen, sie kennen die Gefahren nicht – woher auch? Und so entstehen dort im Mai 2019 jene Fotos, die die Welt aufregen: der Stau am Hillary Step, einer Felsstufe unterhalb der Bergspitze. Auf der einen Seite der Menschenschlange geht es 1000 Meter runter nach Nepal, auf der anderen 3000 nach Tibet. Die Leute, die sich ins Fixseil geklickt haben, kommen stundenlang kaum aneinander vorbei – und gehen buchstäblich über Leichen.
Mit einer Inderin, die dort damals tot im Seil hängt, saß Keck am Abend zuvor noch zusammen: „Sie war Mitte 50, vor zehn Jahren schon mal oben und hat mir stolz erzählt, dass sie vom Basislager bis ins Lager 1 nur 14 Stunden brauchte. Ich brauche drei, der Sherpa zwei, unsere Gäste vier Stunden.“ Diagnose: Tod durch Erschöpfung. Wie soll es jemand auch zügig durch die Todeszone schaffen, wenn er schon 3000 Höhenmeter im Schneckentempo unterwegs ist? Und es zügig durch die Todeszone zu schaffen ist essenziell, um sie zu überleben. Der Körper verbraucht dort, oberhalb von Lager 4 auf 8000 Metern, mehr Sauerstoff, als er aufnehmen kann – egal, wie viel man atmet. Das kann zur Höhenkrankheit führen bis hin zum Hirn- oder Lungenödem. In jedem Fall aber führt es dazu, dass der Körper nicht mehr regeneriert. Selbst wer nur dasitzt, baut körperlich ab – und läuft Gefahr, sich ohne Bewegung in der extremen Kälte Erfrierungen zu holen. Darum ist ein Stau dort so gefährlich. „Geht dir auch noch der Sauerstoff aus, ist das Desaster perfekt“, sagt Keck. „Du kannst nicht mehr denken, und dann ist es vorbei.“
Rund 300 Menschen haben bislang am Everest ihr Leben verloren, ein Drittel davon Sherpas. Die meisten sterben oberhalb von 8000 Metern während des Abstiegs. Jahrelang lagen etwa 200 Leichen dort oben. Weil die Bergung so schwierig ist. Mittlerweile würden am Ende der Expedition alle Toten geborgen, erzählt Keck, denn man müsse 25.000 Dollar Gebühr für eine liegen gelassene Leiche zahlen.

Lange gibt es diese Regelung noch nicht, und so trafen Bergführer jahrelang auf alte Bekannte: den Bulgaren in der Lhotse-Flanke knapp unter Lager 3, der mit blankem Bauch kopfüber im Fixseil hing. Oder den 1996 erfrorenen Inder mit den grünen Schuhen, der auf der Nordseite zu einer Art Wegweiser wurde, Spitzname: Green Boots. Als würde er nur kurz rasten, lag er 18 Jahre am Wegrand – bis er irgendwann weg war, womöglich in die Tiefe gestoßen. Noch immer auf dem Berg, aber nicht mehr direkt am Weg zum Gipfel, liegt der Leichnam des Briten David Sharp. Der erlangte 2006 traurige Berühmtheit, weil mehr als 40 Bergsteiger einfach an ihm vorbeigestapft sein sollen, als er wenige Hundert Meter unterhalb des Gipfels wegen Sauerstoffmangels im Sterben lag.
Nachdem Keck bei seiner Solo-Begehung am Everest 2008 knapp mit dem Leben davongekommen ist, bleibt er dem Berg lange fern. Erst 2019 kehrt er zurück. Der Grund: ein Angebot von Russel Brice, einem der erfahrensten und renommiertesten Expeditionsleiter am Everest. Der Neuseeländer bietet Keck einen Job als Guide an. Keck mag die Art, wie Brice Everest-Expeditionen angeht. Seit 1974 führt Brice Touren und geriet nur einmal in die Kritik: als sein Team – Brice selbst war weiter unten – am sterbenden Briten Sharp vorbeistapfte. Seine Firma Himex bewirbt er so: 59 Expeditionen, 575 Kunden, 296 Gipfelbesteigungen, 0 Tote.
Eine Saison lang arbeitet Keck als Guide für Himex, dann unterbreitet Brice ihm erneut ein Angebot: Er will ihn vom Guide zum Firmenteilhaber machen. Brice mag nicht mehr, ihm missfällt die Entwicklung am Berg. Und er ist pleite, kann Keck keinen Lohn zahlen, obwohl jeder Kunde 75.000 Dollar abdrückt. Seit Jahren schon versucht Brice erfolglos, die Firma Himex zu verkaufen. Jetzt sagt er zu Keck: „Du kriegst das Business in Nepal und Pakistan, aber dafür keinen Lohn, Deal?“ Keck erbt einen weltweit bekannten Namen. Was für eine Chance! Doch dann kommt Corona.
So voll wie vor der Pandemie wird es in diesem Jahr wohl noch nicht, glaubt Keck: „Ich schätze, dass es nur etwa halb so viele wie bei der letzten Everest-Expedition versuchen werden. Da ist schon noch viel Unsicherheit, weil sich die Covid-Regulierungen ständig ändern.“

Was hingegen feststeht: Keck wird versuchen, die Dinge bei seiner Expedition wieder so zu machen, wie sie seiner Meinung nach gemacht werden müssen. Das beginnt mit der Gewöhnung der Gäste an das Gehen in immer größeren Höhen. Bei manch anderem Expeditionsanbieter falle sie mittlerweile weg, sagt Keck, einer lasse seine Kunden gleich mit dem Heli ins Basislager fliegen. Keck dagegen absolviert mit seinen Leuten zur Vorbereitung eine Tour am Siebentausender Pumori: ein klettertechnisch wesentlich anspruchsvollerer Berg als der Everest. Danach weiß der Expeditionsleiter recht genau, ob seine Kunden überhaupt everesttauglich sind.
Ein weiterer wichtiger Punkt für Keck, gerade in der Todeszone: das Verhältnis von Kunden zu Bergführern und Sherpas. Bei Himex bekommen zwei Gäste einen Bergführer sowie zwei Sherpas – bei den Billiganbietern ist man wesentlich schlechter betreut, was auf der Gipfeletappe tödlich enden kann. Zudem gibt es genaue zeitliche Vorgaben. Bei Keck hat für die letzte Etappe ab Lager 4 jeder Bergsteiger vier Flaschen Sauerstoff, die jeweils für etwa vier Stunden reichen. Die Flaschen sind auf dem Weg zum Gipfel an bestimmten Punkten deponiert, und es ist vorher genau festgelegt, welche Wegstrecken innerhalb welcher Zeiträume zurückgelegt werden müssen. „Wenn du dich an solche Regeln nicht hältst, hast du früher oder später einen Toten“, sagt Keck. „Der kleinste taktische Fehler lässt Leute sterben.“
Begangen werden diese Fehler, so sieht es Keck, oft aus der simplen Gier, den Gipfel zu erreichen. Einige Agenturen, sagt er, lebten davon, dass sie ihren Kunden den Erfolg versprechen. Ein gefährlicher Deal. Und ein trügerischer. Ein Anbieter sei bekannt dafür, seine Everest-Besteiger stets mit zwei identischen Daunenanoraks auszustatten: einem für den Gast, einem für den Sherpa. Das Gipfelfoto zeige dann einen Mann im Daunenanorak. Wer das nun wirklich ist? Tja. Auch eine Methode, den – vermeintlichen – Gipfelerfolg sicherzustellen.
„Meine Art der Regulierung wäre: den Sauerstoff verbieten! Wer nicht mit eigener Körperkraft raufkommt, sollte da auch nicht hin“ – Stephan Keck über den Irrsinn am Mount Everest
Seine Kunden auf Biegen und Brechen auf den Gipfel zu befördern ist für Keck undenkbar. „Wenn jemand trotz Sauerstoff Erfrierungen kriegt, weil er so langsam ist, dann ist es egal, was der zahlt und was er danach erzählt, da gibt’s nur eines: umkehren.“ Neben Logistik, Taktik und Wetterkenntnissen sei daher vor allem der psychologische Umgang mit den zahlenden Abenteurern die Herausforderung am Everest, sagt Keck. Manche muss man zum Überleben überreden. „Sie wollen immer weitergehen, auch wenn es ihnen beschissen geht. Da oben stirbt aber niemand, weil er abstürzt, sondern weil sich die Leute nicht an Regeln halten.“
Dabei ließen sich all die Dramen am Everest auch auf ganz simple Weise beenden. Nepals Regierung zum Beispiel wollte mal eine Art Höhenführerschein einführen, doch der Vorschlag wurde nie umgesetzt. Keck hat eine andere Idee: „Meine Art der Regulierung wäre: den Sauerstoff verbieten! Dann hätte sich das mit dem Massenandrang schnell erledigt. Wer nicht mit eigener Körperkraft raufkommt, sollte da auch nicht hin. Das war immer meine Devise. Aber wenn man in dem Geschäft mitmischen will, kommt man um den Sauerstoff nicht herum.“ Um den Zustieg zu regulieren, könne man als Qualifikation auch die Besteigung eines anderen Achttausenders ohne Sauerstoff verlangen. „Dann hätten wir 75 Prozent weniger Menschen am Berg.“

Allerdings wäre dann auch das Geschäft weg. Sein Geschäft. Keck sagt: „Aus Sicht eines Bergsteigers wäre mir das egal. Wir haben genug andere Spielplätze für unser Geschäft. Wir müssen nicht auf dem höchsten Gipfel der Welt so einen Zirkus aufführen.“
Aber warum mischt er dann mit in diesem Zirkus? Es zwingt ihn ja niemand, Menschen auf den Everest zu führen. Keck hat darauf eine klare Antwort: Er will es künftig bleiben lassen. „Für mich ist nach dieser Tour das Thema Everest mit Sauerstoff abgeschlossen. Wir werden umstrukturieren und künftig mehr auf Gipfel mit weniger Leuten gehen.“ Das bedeutet zwar geschäftliche Einbußen, aber die nimmt er gern in Kauf: „Ich bin nicht mehr so ganz jung und brauche nicht mehr so viel Geld oder Erfolg“, sagt er. „Ich will eher meinen Frieden finden da draußen.“
