Patrick Stewart: „Ich schwöre Ihnen: Vor ungefähr sechs Monaten war ich noch vierzig!“

Menu


Nacktaufnahmen statt Notaufnahme: Bei uns trägt Ines Quermann, Star der RTL-Krankenhaus-Serie „Nachtschwestern“, garantiert keinen Kittel …
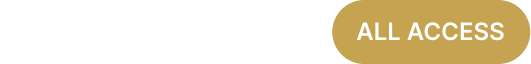
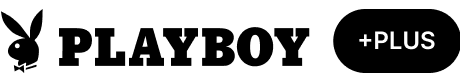
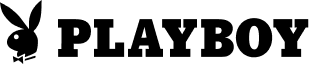
 E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben
E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben 250.000+ exklusive Fotos und Videos
250.000+ exklusive Fotos und Videos Internationale Coverstars und Playmates
Internationale Coverstars und Playmates 70 Jahre Playboy-Geschichte
70 Jahre Playboy-Geschichte 250.000+ exklusive Fotos und Videos
250.000+ exklusive Fotos und Videos Internationale Coverstars und Playmates
Internationale Coverstars und Playmates 70 Jahre Playboy-Geschichte
70 Jahre Playboy-Geschichte inkl. E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben
inkl. E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche
Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben
Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper
Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper Alle Stories auf Playboy.de
Alle Stories auf Playboy.de Alle Stories auf Playboy.de
Alle Stories auf Playboy.de Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper
Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben
Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche
Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche Die Galerie des Tages
Die Galerie des Tages Abstimmung für die Galerie von morgen
Abstimmung für die Galerie von morgenJährlich
20 % SPAREN
1,99 € pro Woche
3,99 € pro Woche
4-wöchentlich
2,49 € pro Woche
4,99 € pro Woche
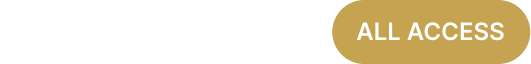
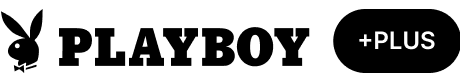
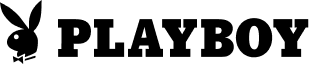
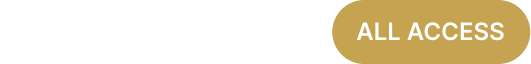
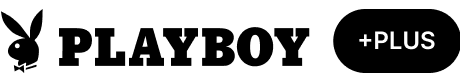
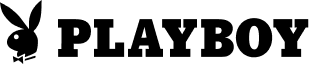
 E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben
E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben 250.000+ exklusive Fotos und Videos
250.000+ exklusive Fotos und Videos Internationale Coverstars und Playmates
Internationale Coverstars und Playmates 70 Jahre Playboy-Geschichte
70 Jahre Playboy-Geschichte 250.000+ exklusive Fotos und Videos
250.000+ exklusive Fotos und Videos Internationale Coverstars und Playmates
Internationale Coverstars und Playmates 70 Jahre Playboy-Geschichte
70 Jahre Playboy-Geschichte inkl. E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben
inkl. E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche
Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben
Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper
Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper Alle Stories auf Playboy.de
Alle Stories auf Playboy.de Alle Stories auf Playboy.de
Alle Stories auf Playboy.de Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper
Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben
Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche
Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche Die Galerie des Tages
Die Galerie des Tages Abstimmung für die Galerie von morgen
Abstimmung für die Galerie von morgenJährlich
20 % SPAREN
1,99 € pro Woche
3,99 € pro Woche
4-wöchentlich
2,49 € pro Woche
4,99 € pro Woche
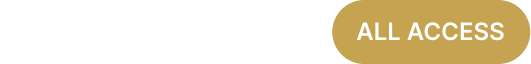
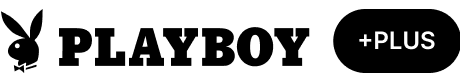
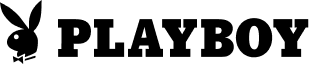
First Lady: GZSZ-Jubiläums-Star Ulrike Frank
Ein guter Monat für: Grand-Prix- und Speed-Fans
20 Fragen an . . . Don Johnson
Männerreise: Die Gipfel der Alpen-Architektur
Die Reise meines Lebens: Der Kolumnist Harald Martenstein sucht Spuren seiner Vorfahren in Afrika
Motor: Der Alleskönner BMW X5M Competition
Playboy-Umfrage des Monats: Was sind die liebsten Freizeitbeschäftigungen des deutschen Mannes?
Der Hurrikan-Jäger: Was der Amerikaner Josh Morgerman im Inneren der gefährlichsten Stürme der Welt sucht – und wie er dort überlebt
Patrick Stewart: Der Kino-Star über seine „Star Trek“- Rückkehr mit 79, das Leben mit seiner viel jüngeren Frau und was er an Pitbulls und Cannabis schätzt
Nico Rosberg: Der einstige Formel-1-Pilot und Weltmeister über die Zukunft des Motorsports, des Straßenverkehrs und seine eigene als grüner Investor
Die Wildkatze: Eine rasante Testfahrt durch Portugal im runderneuerten Jaguar F-Type R
Plötzlich purer Luxus: Auf unserem 2000-Kilometer-Roadtrip sammelten wir Anhalter vom Wegesrand
auf – mit einem Rolls-Royce Dawn Black Badge
Mein Schlitten: Thomas Schwertfirm und sein Fiat 500 Jolly
Feuer frei: Eine Einstimmung zum Grillsaisonstart
Pro & Contra: Nur Kohle zählt – oder geht auch Gas?
Heiße Geräte: Grills für jeden Ort und Typ
T-Bone à la Chef: Steak-Tipps vom Spitzenkoch
Tolle Tools: Das beste Werkzeug für Grillmeister
So grillt die Welt: Kulturenvergleich der Feuerküche
Sechs Bier, bitte: Wir servieren „New Style Pilsner“
Beilagen & Gewürze: Alfons Schuhbeck gibt Nachhilfe
Nacktaufnahmen statt Notaufnahme: Bei uns trägt Ines Quermann, Star der RTL-Krankenhaus-Serie „Nachtschwestern“, garantiert keinen Kittel ...
Playmate: Miss Juni Jeany Waldheim tankt Kraft für ihren Job als Krankenschwester
Blende Sechs: Wer ist die US-Playmate des Jahres? Alle zwölf! So eine Siegesfeier gab’s noch nie
Wohnen: Möbel und mehr fürs Sweet Home
Mode: Outdoor-Kombis für alle Wetter
Pflege: So schneidet man seine Haare selbst
Gerät schlau, Mensch doof: Unser Autor warnt vor Verblödung durch künstliche Intelligenz
Ich rette dich, Baby: Unser Schürzenjäger versucht, als Bademeister Frauen zu beeindrucken
Tagebuch einer Verführerin: Sex-Kolumnistin Sophie Andresky weiß erotischen Rat für die Krise
Clint Eastwood: 90 Jahre und noch immer kein Clint von Traurigkeit – eine Würdigung des ältesten Haudegens Hollywoods
Literatur, Musik & Serien: Das Beste des Monats
Als das „Raumschiff Enterprise“ 1966 erstmals in unendliche Weiten startete, war nicht abzusehen, welche kulturellen Einflüsse diese neue Science-Fiction-Serie auf die kommenden Jahrzehnte der Fernsehunterhaltung haben sollte. 1987, als Sir Patrick Stewart alias Captain Jean-Luc Picard das Steuer übernahm, hatte der „Star Trek“-Mythos dagegen schon ordentlich an Fahrt aufgenommen – und wuchs gemeinsam mit ihm weiter. Stewart verkörperte den tiefgründigen Weltraum-Kommandeur sowohl in der Serie „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ (bis 1994) als auch in einigen Kinofilmen. Nach 17 Jahren Pause beamte der 79-Jährige sich nun in seine Paraderolle zurück: Die Serie „Star Trek: Picard“ ist bei Amazon Prime Video zu sehen und Stewart nicht nur Titel-Star, sondern auch einer der Produzenten.
Mr Stewart, zwischen Ihrer Zeit bei „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“ und Ihrer neuen Serie „Star Trek: Picard“ hat das Internet Einzug in die Welt gehalten. Wie haben Technologie und soziale Medien Ihr Leben und Ihre Arbeit verändert?
Als die ersten iPhones rauskamen, scherzten wir: „Sehen die Dinger nicht genau aus wie in ‚Raumschiff Enterprise‘?“ (Lacht) Wir hatten in der Serie ja diese Art Funkgeräte, über die wir uns verständigten – oder zumindest einige von uns. Ich selbst nutze nur einen Bruchteil dessen, was mein Handy kann, schon die Sprach-erkennung verunsichert mich. Heute gibt es Computeranimationen und Spezialeffekte, die viel leistungsfähiger sind als alles, was damals für „Star Trek“ zur Verfügung stand. Man hört ja oft von den schlechten Umgangsformen in den sozialen Medien – ich habe das ein-, zweimal am eigenen Leib erlebt. Man kann nichts mehr kommentieren, ohne wütende Reaktionen hervorzurufen. Das finde ich schade.
Neben Isa Briones, einer Schauspielerin mit asiatischen Wurzeln, stehen noch andere nicht weiße Künstler im Mittelpunkt von „Star Trek: Picard“. Hat eine Science-Fiction-Serie wie diese, die nicht in der Realität verhaftet ist, dennoch die Verantwortung, die reale Welt abzubilden?
Whoopi Goldberg (die afroamerikanische Kinolegende spielte ab der zweiten Staffel von „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahhrhundert“ 1988 die Rolle der Guinan, Anm. d. Red.) hat mir einmal verraten, was es für sie bedeutete, Uhura (erste weibliche schwarze Führungs-figur der „Star Trek“-Urmannschaft, Anm. d. Red.) im Fernsehen zu erleben. Damals habe sie sich gedacht: „Eine von uns hat es geschafft“ – was natürlich irgendwie ironisch und leicht zynisch ist, aber den Kern der Sache trifft. Ich bin immer noch ganz gerührt, wenn ich daran denke. Zum Glück erkennen wir inzwischen unumwunden an, dass es ein Problem gibt, und tun etwas dagegen. Fünf unserer zehn „Picard“-Episoden haben weibliche Regisseure, und ich finde mich oft in Szenen wieder, in denen mehr Frauen als Männer mitwirken.

Der Buchautor und Pulitzer-Preisträger Michael Chabon hat als Showrunner das letzte Wort beim Drehbuch für „Star Trek: Picard“. Wie ist die Arbeit mit einem Autor, der sonst meist allein in seinem stillen Kämmerlein sitzt und schreibt?
Michael ist extrem schlau, offen und interessiert. Seine Begeisterung für die Arbeitsweise von uns Schauspielern ist grenzenlos. Als Executive Producer hatte ich Zugang zum Besprechungsraum der Drehbuchautoren. Es war ein tolles Privileg, Zeuge bei ihrem kreativen Pingpongspiel zu sein, diesen Austausch kennen Schauspieler und Regisseure eher weniger. Einer hat eine Idee, der Nächste greift sie auf und verwandelt sie in etwas anderes, und dann kommt der Dritte und ändert wieder etwas. Das einzig Frustrierende ist, wenn sie am Schluss sagen: „Nein, das funktioniert nicht“ und alles wieder verwerfen (lacht).
„Star Trek: Picard“ enthält zahlreiche Action-Szenen. Wie schaffen Sie jetzt, da Sie älter sind, Ihre Stunts?
Es ist die Hölle. Seit drei Jahren leide ich an einem Drehschwindel. Außer wenn ich schlafe oder Auto fahre, ist mir eigentlich immer schwindlig. Die Ärzte sagen, es
bestehe eine Diskrepanz zwischen den Signalen, die meine Augen ans Gehirn senden, und denen meines Innenohrs. Wenn ich schnell aufstehe, besteht die Gefahr, dass ich umfalle, also muss ich am Set vorsichtig sein. In einer Szene rennen Isa Briones und ich eine Treppe hoch. Das sollte eigentlich ein Stunt-Double übernehmen, aber ich sagte: „Ich versuche es einfach mal selbst.“ Ich rannte die Treppe hoch und fühlte mich wunderbar! Ich glaube, wenn ich spiele, verschwindet das Schwindelgefühl. Gott sei Dank.
Ein Haufen Ihrer alten Kumpel aus „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“ ist auch in „Star Trek: Picard“ wieder dabei, darunter Brent Spiner und Jonathan Frakes. Sind Sie alle immer noch miteinander befreundet?
Ja, wir sehen uns ständig, nur Whoopi treffe ich nicht so oft, wie mir lieb wäre. Es sind großartige Menschen. Beim Film wird die Besetzung einfach zusammengeworfen, doch beim Schauspielen öffnet man sich automatisch. Das schweißt zusammen. Erst neulich habe ich mich bei jemandem gemeldet, mit dem ich 1967 in der Royal Shakespeare Company gespielt habe. Ich hatte gehört, dass er jetzt in Beverly Hills lebt, und habe ihn mit der Hilfe meines Teams aufgestöbert. Sein Name ist Sir Ben Kingsley (lacht). Unsere Wege haben sich natürlich immer mal wieder gekreuzt – aber wenn ich mich richtig erinnere, hat Ben damals sogar ein paarmal auf einer Matratze auf meinem Schlafzimmerboden genächtigt.
Haben Sie jemals darüber nachgedacht, mit der Schauspielerei aufzuhören?
Nein, noch nie! Das würde bedeuten, mein Leben aufzugeben. Wenn ich als Kind eine Rolle übernahm, war ich nicht Patrick Stewart, sondern führte das Leben eines anderen – eines, das besser war als meins. Ich habe mich auf der Bühne immer zu Hause gefühlt. Am besten gefällt mir daran, dass ich im Laufe der Zeit mutiger geworden bin, mein Ich eher zeigen kann. Mein Spiel ist persönlicher, ich übernehme nicht nur eine Rolle.
Der Schauspieler Sir Ian McKellen ist einer Ihrer besten Freunde, 2013 hat er sogar Ihre Trauung vollzogen. Was haben Sie von ihm gelernt?
Homosexuelle haben in meinem Leben als Kollegen oder Freunde immer schon eine Rolle gespielt, aber niemand war so präsent wie Ian. Ich liebe ihn – nicht nur platonisch. Ebenso wie meine Frau, und das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich höre ihm zu, ich beobachte ihn – und zwar nicht nur bei seiner Arbeit. Seine Art zu leben ist bewundernswert, er ist selbstlos und verständnisvoll. Und wir haben verdammt viel Spaß miteinander.
Welcher Star hat Sie am meisten beeindruckt?
Ich erinnere mich an eine Golden-Globes-Party, als mich eine Frau mit starkem Akzent ansprach und um ein Foto bat. Normalerweise sagt man lieber Nein, sonst muss man die halbe Nacht mit irgendwelchen Leuten Selfies machen. Jemand aus der Runde fragte: „Kennen Sie Nadia?“ Ich sagte: „Nein.“ Und er: „Darf ich Ihnen (die Olympiaturnerin, Anm. d. Red.) Nadia Comaneci vorstellen?“ Ich schwöre Ihnen, meine Knie wurden weich. Ich liebe Leichtathletik und Sport, und da stand Nadia Comaneci vor mir. Es war der reine Wahnsinn.
Sie sind ein Verfechter der Cannabis-Legalisierung. Was waren Ihre ersten Erfahrungen mit Marihuana, und wann wurde diese Angelegenheit so wichtig für Sie?
Drogen haben bei mir früher kaum eine Rolle gespielt. Ich war um die 40, als ich das erste Mal mit Cannabis in Berührung kam. Der Grund dafür liegt hier (reibt sich die Hände). Ich leide an Arthritis. Seit ich zweimal täglich eine auf Cannabinoiden basierende Creme verwende, geht es mir viel besser. Und ich erzähle Ihnen noch eine Geschichte: Meine Frau und ich lernten in New York einen Chauffeur kennen, den wir sehr mochten. Er erkrankte schwer an Krebs. Er hörte auf zu essen, schaute nicht mehr fern, las keine Zeitung mehr und wollte nicht mehr telefonieren. Meine Frau besorgte ihm Marihuana, und seine Familie erzählte uns später, dass er seine Lebenserwartung sogar noch übertroffen hat. Und zwar deswegen, weil er wieder ein erfülltes Leben führte. Er aß mit Appetit und machte Witze. Das hat mich grundlegend überzeugt. Cannabis hat medizinische Eigenschaften, die noch nicht ausreichend erforscht sind. Also wurde ich Befürworter der Legalisierung von medizinischem Marihuana.
Zudem schlagen Sie sich auf die Seite der Frauen. Warum haben sich im Zuge der MeToo-Bewegung so wenige berühmte Männer ähnlich konsequent für Frauen eingesetzt wie Sie?
Ich glaube, weil sie nicht wirklich überzeugt sind. MeToo ist für viele Männer schwierig, besonders für jene ab einem bestimmten Alter oder Bekanntheitsgrad. Die männliche Dominanz ist unmerklich Teil unseres Lebens geworden, und zwar auf äußerst komplexe Weise. Ihre Existenz ist nicht zu leugnen, und die Umgangsweise damit ändert sich gerade – auch wenn manche Leute meinen, der Wandel gehe nicht schnell genug. Ich beobachte mit großer Spannung, was um mich herum geschieht und welche Auswirkungen das auf die Karriere und die Selbstachtung der Frauen hat.





Als Sie am Anfang Ihrer Karriere am Theater oder beim Film arbeiteten, haben Sie da Fälle erlebt, in denen Leute schlecht behandelt wurden und in denen Sie gern eingegriffen hätten? Oder war das etwas, das Sie als Teil des kreativen Prozesses akzeptierten?
Ich kann mich nicht erinnern, jemals solche Gedanken gehabt zu haben. Schon auf der Schauspielschule wusste ich ganz genau, was eine Besetzungscouch ist – mit 17! Dieses „Jagdverhalten“ gibt es über-
all. Ich habe es persönlich kennengelernt, als meine Mutter von meinem Vater misshandelt wurde. Deshalb unterstütze ich die britische Organisation Refuge, die sich der Bekämpfung häuslicher Gewalt verschrieben hat.
Sie haben einmal gesagt, dass Sie gerne die amerikanische Staatsbürgerschaft hätten. Wie geht es Ihnen dabei, sowohl Ihr Geburtsland Großbritannien als auch Ihre Wahlheimat USA kulturell und politisch in einem solchen Aufruhr zu erleben?
Seit Kurzem spüre ich so etwas wie Schuldgefühle, weil ich nur noch so selten in England bin. Mein Leben lang war ich politisch links. Ich bin immer noch Mitglied der Labour-Partei, auch wenn mich
inzwischen Vorbehalte plagen. Ich habe Angst. In beiden Ländern gibt es nationalistische Bewegungen, und der Grund dafür liegt unter anderem in der wirtschaftlichen und bildungspolitischen Spaltung. Boris Johnson und Donald Trump sprechen Leute an, die sich als Verlierer fühlen. Die Kluft zwischen Arm und Reich, die erschreckend schnell wächst, und die Klimaerwärmung sind die beiden Themen, die mich am meisten umtreiben.

Lassen Sie uns das Thema wechseln. Sie und Ihre Frau Sunny leben in Park Slope, Brooklyn. Wie war Ihr erster Eindruck von Ihrem neuen Zuhause?
Die Menschen dort sind wirklich etwas Besonderes. Als ich das erste Mal bei Sunny übernachtet hatte, kamen wir an einem Sonntagmorgen im Sommer aus ihrem Haus und sahen zwei Typen auf der Veranda sitzen und rauchen. Einer von ihnen blickte auf, und ich war nicht besonders erpicht auf ein Gespräch. Doch als wir an ihnen vorbeigingen, rief einer von ihnen nur (spricht mit New Yorker Akzent): „Hey, Mr Stewart! Willkommen in der Nachbarschaft. Viel Spaß.“ Das war alles. Kein: „Kann ich ein Selfie mit Ihnen machen?“ Bei dem Gedanken daran wird mir warm ums Herz, ich habe mich noch nie irgendwo so willkommen gefühlt.
Zwischen Sunny und Ihnen besteht ein Altersunterschied von 38 Jahren. Wie wirkt sich das, wenn überhaupt, auf Ihren Alltag aus?
Ich lerne eine Menge von ihr. Sie hat ein unglaubliches Gedächtnis, was wirklich praktisch ist. Vor allem, seit sie mich das erste Mal in London besucht und – in ihren Worten – „alten Krempel“ kennengelernt hat. Sie wird immer mehr zur Expertin auf dem Gebiet der Kunst und Architektur des späten Mittelalters und der Frührenaissance. Wenn wir eine Kirche besichtigen, kann sie mir alles erklären, weil sie vorher gründlich recherchiert hat. Aber ob ich über unseren Altersunterschied nachdenke? Zugegebenermaßen nicht besonders oft. Ich mache mir keine Gedanken darüber. Allerdings ist es schon vorgekommen, dass die Leute sagen: „Sie und Ihre Tochter …“ Meine Antwort ist dann immer: „Danke für das Kompliment!“ (Lacht)
Was sagt Sunnys Familie zu Ihrer Beziehung?
Ich glaube, anfangs waren sie sich nicht ganz sicher, was sie davon halten sollten. Doch in meiner Hochzeitsrede sagte ich: „Ich möchte endlich zu dem Gerücht Stellung beziehen, dass ich Sunny nur geheiratet hätte, um in der Nähe ihrer Eltern zu sein. Das ist die absolute Wahrheit!“ (Lacht) Wir verstehen uns blendend und lachen viel miteinander. Sunnys Eltern haben eine Hütte in Alpine Meadows in Kalifornien. Ich habe mit 64 Jahren Skifahren gelernt! Ich versuchte, Sunnys Vater die Sache auszureden: „Ich kann das nicht. Ich will einfach vor dem Kamin sitzen, ein Buch lesen und gemütlich Kaffee trinken.“ Darauf er: „Wir haben einen Skilehrer engagiert, der dich vier Stunden am Tag unterrichtet.“ Am Abend des vierten Tages bestieg ich leicht nervös die Gondel zum Gipfel und fuhr ganz allein die Piste hinab. Es war wirklich aufregend. Ich hatte früher stundenlang Abfahrtsrennen im Fernsehen gesehen, und plötzlich stammte dieses Geräusch (zischt) von mir selbst!
Sie werden diesen Juli 80. Wissen Sie schon, wie Sie Ihren Geburtstag feiern?
Sunny ist schon seit Monaten mit den Vorbereitungen beschäftigt. Wir feiern in Los Angeles und vielleicht auch in London. Ich weiß wirklich nicht, wie das passiert ist: Ich schwöre Ihnen, vor ungefähr sechs Monaten war ich noch 40! Ich erinnere mich genau: Wir filmten „Excalibur“ mit Regisseur John Boorman. Obwohl ich den ganzen Tag in voller Rüstung ausharrte, kam ich nicht dran. Ich flehte John an: „Heute ist mein 40. Geburtstag. Kann ich nicht wenigstens im Hintergrund im Bild sein?“ Doch er blieb hart. Ich bin dankbar, dass ich relativ gesund bin, arbeiten kann, beschäftigt bin, eine unglaubliche Frau mit einer Familie habe, die irgendwie auch zu meiner Familie geworden ist. Manchmal habe ich ein bisschen Bammel. Ich kann mir nicht erklären, wie ich hier gelandet bin.




Zu Ihren Liebsten gehören auch Tiere. Haben die Sie für das Thema Tierschutz begeistert – und hat dieses Engagement Sie selbst verändert?
Der Auslöser war die Zutraulichkeit und Offenheit unseres ersten Pflegehunds, eines Pitbull-Weibchens namens Ginger. Ich hatte mich über irgendetwas aufgeregt, was ich in der Zeitung gelesen hatte – wie eigentlich jeden Tag –, und sie kam zu mir und blickte mich an. Ihre Augen schienen zu fragen: „Alles okay mit dir?“ Eine Woche später wurde ich krank und musste mich in unserem Bad in Los Angeles übergeben. Da lief sie los und holte Sunny. Wie soll man das erklären? Wir sind vernarrt in Pitbulls, dürfen sie aber wegen des Verbots in England nicht halten. Ich engagiere mich dafür, dass dieses Verbot aufge-hoben wird, da es albern ist: Das Problem sind nicht die Hunde, sondern die Besitzer.
Als Sie uns vor knapp 30 Jahren ein Interview gaben, sagten Sie auf die Frage, welche fünf Platten Sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden: drei Klassikalben, eine Originalaufnahme des Musicals „Sweeney Todd“ und eine Aufnahme Ihres Freundes Brent Spiner von „Ol’ Yellow Eyes Is Back“. Hat sich Ihr Musikgeschmack seitdem verändert?
Die letzten 25 oder 30 Jahre hat Pop für mich nicht existiert. Dann traf ich Sunny, die ständig Musik hört. Country habe ich zu lieben gelernt, mit Hip-Hop habe ich so meine Probleme. Ich werde nie vergessen, wie ich Sunny das erste Mal auf der Bühne sah. Ich wusste nicht, dass sie Sängerin ist, und sie sagte: „Ich hab ’nen Gig.“ Ich hatte keine Ahnung, was ein Gig ist! Sie erklärte mir, der Auftritt finde im East Village statt, zwischen 23 und 24 Uhr. Was? Wann? Ich weiß noch, wie ich im Laufe des Abends langsam nervös wurde. Was, wenn das Ganze die halbe Nacht dauerte? Endlich war sie an der Reihe – nach Mitternacht. Und es war toll, einfach wunderbar.
Im selben Interview schworen Sie auch, in der Öffentlichkeit nie als Jean-Luc Picard aufzutreten oder Sprüche aus „Raumschiff Enterprise“ zu zitieren. Sind Sie in diesen Fragen immer noch so strikt?
Nein, da bin ich deutlich entspannter geworden. Es wäre doch kindisch – oder vielmehr total bescheuert –, wenn ich immer noch darauf beharren würde nach dem Motto: „Nein, nein, nein, ich sag aber nicht ‚Energie‘!“
Interview: Stacey Wilson Hunt - Übersetzung: Sabine Hohenester