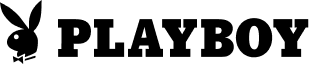Fotos & Film: Flo Smith / Max Marquardt Musik: "Dr.Turtle"
Der Mensch und die Alpen, das ist eine ganz eigene Geschichte. Seit jeher ist das höchste Gebirge des mittleren Europas ein Hort der Sehnsüchte und des Abenteuers. Es zu überqueren - von Nord nach Süd oder umgekehrt - übt eine starke Faszination aus. Auch auf uns vier Rosenheimer Jungs.
Der Plan ist eigentlich banal. Vielleicht deshalb, weil wir ihn beim Freitagsbier in der heimischen Kneipe fassen: Auf Fahrrädern vom oberbayerischen Rosenheim bis ins ferne Mailand fahren. Brenner rauf, Brenner runter – und ehe man sich versieht, sitzt man bei Pizza und Vino im warmen Süden.
Aber das wäre zu einfach.
"Kann ja nicht so schwer sein"
„Rennrad kann ja jeder“, sagen wir uns, während die Bierflaschen klirren. Wir, dass sind die Mitglieder der "Rosencrime Bike Crew" – einer Interessensgemeinschaft von Fahrradfreaks – und ich.

Wir überlegen uns einen zusätzlichen Kitzel: Wir wollen mit sogenannten Fixies fahren – Bahnrädern also. Sie verfügen weder über Gänge oder Freilauf noch über Bremsen.
Und wie der Name schon sagt: Bahnräder sind für Bahnen aus Holz gedacht und nicht dafür, zehn Stunden täglich irgendwelche Alpenstraßen hochzustrampeln.

Ein bisschen fahrlässig ist unser Vorhaben also schon. „Kann ja nicht so schwer sein“, machen wir uns am Tresen gegenseitig Mut.

Aufbruch ins Ungewisse
Wir starten an einem Samstagvormittag die Reise ins Ungewisse – voller Spannung. Vier Fahrer und ein Support-Fahrzeug mit Ersatzteilen, Wasser und jeder Menge Power-Riegel.

Die Strecke von Rosenheim bis Mailand beträgt etwa 590 Kilometer. Für unsere „Tour de Milano“ planen wir Etappen mit jeweils 120 bis 140 Kilometern pro Tag. Uber Innsbruck, Sterzing, Bozen, Gardasee wollen wir nach fünf Tagen das Ziel erreichen.
Aufbruch ins Ungewisse
Wir fahren auf der ersten Etappe kraftsparend – so gut das bei Bahnrädern geht: Aufgrund der starren Naben muss ununterbrochen getreten werden. Auch wenn es bergab geht.
Möchten wir bremsen, müssen wir uns mit aller Beinkraft gegen die sich drehenden Kurbelarme der Pedalen stemmen. Auf diese Weise blockiert das Hinterrad und wir kommen (wenn alles gut geht) nach ein paar Metern Bremsweg zum Stehen.

Zu meiner persönlichen Überraschung halten die filigranen Bahnräder durch. Die ersten 125 Kilometer bis Innsbruck meistern wir ohne Probleme. Zumindest die anderen tun das.
Bei mir geht überhaupt nichts mehr weiter. Schon nach der ersten Etappe spüre ich massive Schmerzen im linken Knie. Ohne zusätzliche Hilfe werde ich es nicht weiter schaffen. Ich muss deshalb eine Bremse ans Vorderrad montieren.
Die Brenner-Etappe
In Innsbruck gibt es Bier und Gegrilltes. Ein langer Abend: Wir packen alte Geschichten aus, von verrückten Trips, geisteskranken Autofahrern und vergangenen Liebschaften. Die Nervosität ist trotzdem spürbar. Alle haben Ehrfurcht vor dem kommenden Tag. Vor der Brenner-Etappe.


Der Sonntag begrüßt uns mit strahlender Sonne und „angenehmen“ 32 Grad Celsius. Die Brenner-Etappe soll die kürzeste, aber zugleich härteste Etappe der Tour werden. Insgesamt müssen wir an diesem Tag knapp 3000 Höhenmeter auf einer Strecke von 90 Kilometern meistern.
Beim Start ist es gespenstisch still, niemand traut sich, etwas zu sagen. Schon kurz nach Innsbruck geht es massiv steil bergauf. Was für Fahrräder mit Gangschaltung relativ moderat wäre, ist mit dem Fixie eine zähe Tortur für Waden und Oberschenkel. Wie ein Oma-Rad im dritten Gang. Und damit schrauben wir uns Meter für Meter in sengender Hitze über den Brenner.

Warum mussten es unbedingt Bahnräder sein? Wäre der Trip nicht auch mit Rennrädern oder Mountainbikes schon anstrengend genug? Über diese Fragen (und vieles anderes) denke ich während der Etappe nach. Wie viele Sportler haben sich in den Alpen bereits unsterblich gemacht? An wie vielen schroffen Felsen haben sich aber auch ganze Expeditionen zugrunde gerichtet?
Die Abfahrt
Noch schwieriger als der Aufstieg ist die anschließende Abfahrt. Ohne Bremsen donnern wir mit Geschwindigkeiten bis zu 50 Stundenkilometern die alte Brennerstraße und später den stillgelegten Bahndamm in Richtung Sterzing hinunter. Beim Betrachten meiner popeligen Vorderradbremse, die bei jeder Abfahrt knarzende Töne von sich gibt, wird mir mulmig zumute.

Beim Fixed-Gear-Radfahren entscheiden sich die Fahrer bewusst gegen die Freiheit, ihren Beinen eine Pause zu gönnen. Aber warum eigentlich, frage ich mich jetzt selbst? Wollen wir unsere eigenen Grenzen ausloten? Wollen wir uns einfach nur mit dem Vorhandenen (oder dem eben nicht Vorhandenen) beweisen?
Vielleicht liegt genau in der radikalen Reduktion jene Essenz der Freiheit, die für so viele Extremsportler wichtig ist. Für mich selbst finde ich keine Antworten auf meine Fragen. Ich fahre einfach weiter.
Abschied ist schwer
Nach fast neun Stunden ununterbrochener Strampelei, diversen Platten und kleineren Pannen kommen wir wohlbehalten am Ziel an. Die härteste Etappe ist geschafft und die Erleichterung uns allen ins Gesicht geschrieben.

Dort verabschiede ich nach einem gehaltvollen Mahl (Pizza und Bier) die Fahrer der „Rosencrime Bike Crew“ und wünschte allen viel Glück und eine gute Weiterreise. Für mich ist hier Schluss. Ich muss zurück nach München, zurück in die Arbeit. Am meisten freuen sich wohl meine Beine auf diesen Abschied.
Bis zur völligen Erschöpfung
Am Folgetag legt der Tross – jetzt ohne mich – eine Distanz von 180 Kilometern zurück. Obwohl die Strecke weniger Anstiege hat als die des Vortags, schwinden bei allen Beteiligten die Kräfte. Geplagt von Wadenkrämpfen und Gesäßschmerzen ist aufgrund des einsetzenden Regens in Brenzone vorerst Schluss.


Von dort geht es am nächsten Tag weiter. Bei unerträglichen Temperaturen von über 35 Grad und rekordverdächtigen 200 Kilometern auf staubigen Bundesstraßen erreichen die Fahrer endlich das ersehnte Ziel - und davor das kühle Nass des Lago di Garda. Aufgrund ihrer desolaten Verfassung entscheiden die Fahrer, einen Ruhetag einzulegen.

Nachts erhalte ich diverse WhatsApp-Nachrichten und Fotos: die Fahrer im See stehend, nur mit ihren Race-Caps bekleidet. Von den Videos erzähle ich an dieser Stelle besser nichts. Es gibt anscheinend keinen Grund zu größerer Sorge.
Der Sturm auf Mailand
Nach dem erholendem „Day-Off“ satteln die Fahrer zum finalen Sturm auf Mailand. Die letzte Etappe hat es nochmal in sich. Am Ende kollidiert einer der Fahrer sogar mit einem Auto. Glück im Unglück: Das Rad ist hin, dem Fahrer fehlt jedoch so gut wie nichts. Welch dramatisches Fanal.

Mit dem Ziel vor Augen werden nochmal sämtliche Kraftreserven mobilisiert. Mit einem sagenhaften Schnitt von 30 Stundenkilometern erreichen die drei Fahrer nach zehneinhalb Stunden Fahrtzeit endlich die Stadttore Mailands.
Sie haben es geschafft! Überglücklich und völlig erschöpft. Das Klirren der Bierflaschen hört man an jenem Abend wohl bis in die Heimat, bis nach Rosenheim.