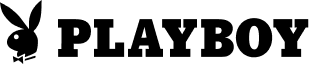Serge Gnabry erscheint bestens gelaunt in der Suite des „Roomers“-Hotels in München. Es ist sein erster freier Tag seit Wochen. Handschlag mit seinem Stylisten, den er aus London für unser Foto-Shooting hat einfliegen lassen, dann macht er die Runde und stellt sich mit „Serge“ vor. Er trägt einen weißen Designer-Trainingsanzug, kombiniert mit einem schwarzen Lederrucksack und Dreitagebart.
Herr Gnabry, Sie ziehen sich gern ausgefallen an. In welchem Alter wurde Mode für Sie zum ersten Mal so richtig interessant?
Während meiner Zeit in London. Man sieht dort Sachen auf der Straße, die man hier nie sehen würde. Mit meinem Style steche ich hier easy raus – dort falle ich keinem auf.
In welchem Outfit fühlen Sie sich am wohlsten?
Das hängt von Stimmung und Anlass ab. Ich habe angefangen, mich noch mehr mit Mode zu beschäftigen, arbeite mit einem Stylisten daran, dass mein Kleiderschrank noch ein bisschen besser aussieht und ich mich auch besser fühle.
Ihr erster Arbeitstag beim FC Bayern: Da überlegt man ja, was man anzieht. Was haben Sie fürs erste Training aus dem Schrank geholt?
Ganz normal: eine Jogginghose. Mache ich auch heute noch so. Ich hab einen kurzen Weg zum Training. Da gehe ich auch mal lässiger: Jogginghose, Pulli, Tracksuit.

Wer gibt in der Bayern-Kabine eigentlich modisch die Richtung vor?
Es ist eine bunte Kabine. Natürlich ist Jérôme (Boateng; d. Red.) modisch dabei, Leon (Goretzka) interessiert sich dafür, Mats (Hummels) auch. Mein Freund Jo (Joshua Kimmich) dreht dagegen manchmal durch, wenn er sieht, wie ich rumlaufe.
Ihm haben Sie zum Schnauzbart geraten: ein Freundschaftsdienst oder eher ein Streich?
Er wollte einen Vollbart, dafür hat sein Bartwuchs aber nicht gereicht. Ich hab zu ihm gesagt: „Mach ’nen Schnauzer – das ist krank!“ Er wollte nicht, aber vor dem Pokalspiel in Rödinghausen klopft er im Hotel an meine Tür, steht da, grinst und zeigt nur auf seinen Schnauzer. Und ich so: „Oh Shit, er hat’s gemacht!“ Aber es sah richtig lustig aus. Mir gefällt’s. Ich hab gesagt: „Wenn du ihn dranlässt, ziehe ich mit.“ Am nächsten Tag hab ich mir auch einen Schnauzer geschoren.
Er hat seinen seitdem behalten.
Ja, er fühlt seinen noch! Ich dagegen bin gerade am Struggeln ... Mal sehen, vielleicht rasiere ich mir auch wieder einen. Ich finde Schnauzer ja geil – weil es so unique ist ...
Serge Gnabry guckt kurz, als würde er in Sachen Schnauzer in sich hineinhorchen. In etwa 40 Minuten, am Ende unseres Gesprächs, wird er eine Antwort gefunden haben – und den anwesenden Barbier bitten, ihm für unser anschließendes Foto-Shooting einen zu rasieren.
Auf wessen Meinung, außer der Ihres Stylisten, legen Sie selbst Wert in Modefragen?
Auf gar keine. Es gibt sowieso jeder seinen Senf dazu. Ist aber kein Problem für mich.
Sie sind großer Musik-Fan. Womit stimmen Sie sich auf ein Spiel ein?
Verschieden. Manchmal mit afrikanischer Musik aus der Heimat meines Papas, der Elfenbeinküste. Sachen, die ich mir dort aufgenommen habe, aus den 80ern, 90ern und 2000ern. Wenn ich gut drauf bin, bringt mich das noch mehr in Fahrt. Eine sehr fröhliche Musik. Witzig sind auch die Storys, die mein Vater dazu erzählt, weil ich die Texte ja nicht verstehe. Und ich höre natürlich viel Hip-Hop. „A Lot“ von 21 Savage und J. Cole ist gerade mein Go-to-Lied, das ich als letztes anhöre, bevor ich rausgehe.
Was ist der perfekte Soundtrack, um die Meisterschaft zu feiern?
„Trophies“ von Drake featuring Migos.
Und um die verlorene Meisterschaft zu betrauern?
Den werden wir nicht brauchen (lacht).
Wer legt vor Spielen in der Bayern-Umkleide auf?
Rafinha. Wir haben eine Box in der Kabine, da haut er seine Latino-Musik rein. Brasilianische Songs haben ja immer einen guten Beat. Rafinha ist gerade noch der Musik-Chef ...
Ist das eine Bewerbung? Sie waren bei Olympia 2016 ja der Kabinen-DJ.
(Lacht) Ich muss nicht, ich bin entspannt. Manchmal brauche ich vor dem Spiel auch gar keine Musik, mache meine Übungen, entspanne mich.
Haben Sie Rituale vor dem Match?
Ich mache Übungen: dehnen, Stabilisation, aber auch Augenübungen, rede in Gedanken mit mir selbst, um den Fokus komplett auf die 90 Minuten zu richten. Das sind Übungen, die aus dem Neuroathletiktraining stammen. Ich mache das seit ein, zwei Jahren.
Wie kamen Sie darauf?
Ich habe gelernt, dass das Mentale eine große Rolle spielt, egal, in welchem Sport. Und ich merke, dass es besser läuft, wenn ich mich ganz gezielt und intensiv konzentriere.
Unterschätzen die Fans, wie wichtig der Kopf beim Fußball ist?
Viele wissen nicht, was da mental alles dahintersteckt. Aber wenn du im Kopf nicht stark bist, wird’s schwer.

Im Kopf stark sein: Das mussten Sie bereits mit 16 Jahren, als Sie aus der Jugend des VfB Stuttgart nach London zum FC Arsenal gewechselt sind.
Ja, da wurde mir zum ersten Mal so richtig bewusst: Du wirst Profi. Ich habe gemerkt: Okay, Schule ist vorbei. Es ist jeden Tag Fußball! Jetzt musst du dich durchbeißen. Das war nicht einfach. Alles ging relativ schnell: Mit 16 habe ich in der zweiten Mannschaft gespielt, hatte in der nächsten Saison meinen ersten Profi-Einsatz. Dort ist es üblich, dass die U18-Spieler mit den Profis mittrainieren, was eigentlich Wahnsinn ist. Da schlottern dir erst mal die Beine, gerade bei einem Verein wie Arsenal!
Ihr Coach war damals Trainer-Legende Arsène Wenger – auch ein spezieller Typ, oder?
Da gab’s viele spezielle Typen. Wir Profis haben, glaube ich, sowieso alle irgendwo eine Macke. Es hat mir am Anfang sehr geholfen, dass Wenger Deutsch sprechen konnte, weil mein Schulenglisch zwar gut, aber nicht tipptopp war. Die ersten zwei, drei Monate hab ich in der Kabine gar nichts verstanden, wenn der Trainer geflucht hat. Wenger ist ein Trainer, der Spielern sehr viel Eigenverantwortung gibt, genau beobachtet, wie du dich einfügst. Er hat jungen Spielern Chancen gegeben – deshalb bin ich auch zu Arsenal und speziell zu diesem Trainer gegangen.
Ihr Vater ist damals mit Ihnen nach London gezogen. Väter haben ja immer tausend Ratschläge, aber gibt es denn einen, der Sie besonders geprägt hat?
Ich soll mehr machen als die anderen – das war seine Devise und sicher kein schlechter Tipp. Ich bin in Weissach bei Stuttgart aufgewachsen und war der einzige Mischling im Dorf: Da wächst du anders auf, als die anderen.
Mal abgesehen vom Fußball ist in London ja noch so einiges geboten – wie geht man damit um als 16-, 17-Jähriger?
16, 17 ging noch, da konnte man noch nicht so viel machen. Dass mein Vater die ganze Zeit in London dabei war, das war schon gut und wichtig. Seine führende Hand hat mich viel Disziplin gelehrt. Das hilft gerade in dem Alter, wo so viel abgeht. Ich fand’s geil, in so einer Großstadt zu leben. Das prägt natürlich auch für das weitere Leben.
Sie waren also ein vernünftiger Teenager?
Na ja, mit 18, 19, 20 weiß der Papa auch, dass er nicht anrufen muss, wenn ich abends nicht zu Hause bin. Ich war ja oft zusammen mit den Mannschaftskollegen unterwegs. Wir haben auch abseits des Platzes viel Zeit miteinander verbracht. Aber Eskapaden? Nein.
Der Trend geht im Fußball dahin, dass zunehmend Spieler schon in sehr jungen Jahren von großen Clubs angeworben werden. Als jemand, der erlebt hat, wie das für einen jungen Fußballer ist: Wie denken Sie über diese Entwicklung?
Ich habe das Gefühl, dass es immer früher wird. Klar hilft es, wenn man früh weiß, dass man Profi werden will, aber ein Kind sollte auch ein Kind bleiben. Wir werden in ein paar Jahren sehen, wo diese Entwicklung hinführt. Es gibt kein Patentrezept, denke ich. Wer weiß, wo ich wäre, wenn ich in Stuttgart geblieben wäre. Ich habe mich damals für diesen Weg entschieden, wollte dieses Risiko eingehen. Ich hatte schon Bedenken, bin aber halt ein Risiko-Mensch. Viele sagten mir damals, das sei die schlechteste Entscheidung, die ich treffen konnte – ein Jahr später habe ich Premier League gespielt. Viele Wege führen nach Rom, und ich würde meinen noch mal genau so gehen.
Der Weg führte Sie von Arsenal über Bremen und Hoffenheim nach München. Waren Sie Bayern-Fan als Kind?
Ich war früher natürlich beim VfB im Stadion, aber nie der Hardcore-Fan, habe immer gern selber gespielt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal für Bayern spielen werde. Als ich zehn war, gab’s mal ein Angebot von Bayern, aber mein Vater hat abgelehnt.
Waren Sie sauer?
Ich hab bestimmt geheult. Aber der VfB war in der Jugend natürlich auch eine Top-Mannschaft. Als wir dann mit Arsenal gegen Bayern gespielt und auf den Sack bekommen haben, dachte ich mir auch: „Wow, FC Bayern. Was für eine Mannschaft!“ Hätte nicht gedacht, dass es so schnell passiert, dass ich jetzt hier bin.
Das Team befindet sich gerade in einem Umbruch. Auch wenn Sie noch nicht so lange dabei sind: Spüren Sie, dass sich da etwas ändert?
Als Fußballer machst du dir primär um deine Leistung Gedanken. Was den Umbruch betrifft: Das regelt die Chefetage. Es ist geil, mit Jungs wie Jo, Niki (Niklas Süle, d. Red.) und Leon, die ich von früher kenne, zusammenzuspielen und von den erfahrenen Spielern zu lernen, Tipps von ihnen zu bekommen.
Welche Tipps geben Arjen Robben und Franck Ribéry?
Die beiden haben die Flügelzange jahrelang geprägt. Franck gibt mir viel Selbstvertrauen, sagt mir „Geh immer ins Eins-gegen-Eins, auch wenn du hängen bleibst! Wir brauchen das!“ Klar gibt es einen Konkurrenzkampf, aber wir verstehen uns, wir sind Mannschaftskollegen. Es ist viel easier, als das viele Medien beschreiben wollen.
Wie trösten Sie Arjen Robben, wenn er Ihretwegen auf der Bank sitzt?
Den muss ich nicht trösten. Er tröstet mich ja auch nicht, wenn ich auf der Bank sitze (lacht).
Julian Nagelsmann, der Sie in Hoffenheim trainiert hat, meinte, Sie bräuchten ab und zu einen Tritt in den Hintern ...
Ich fand eigentlich, dass ich Gas gegeben habe – aber dann sagte er in einer Besprechung: „Serge, da muss noch mehr kommen!“ Und ich dachte so: „Alter! Ist das dein Ernst?“ Aber es hat Wirkung gezeigt: Danach habe ich eine brutale Rückrunde gespielt.
Ist Nagelsmann ein besonderer Trainer?
Ich hab mich vor meinem Wechsel dorthin mit vielen Kumpels, die unter ihm gespielt haben, unterhalten, und alle sagten: „Das ist ein super Trainer.“ Es ist ja kein Zufall, dass viele seiner Spieler aus dem Nichts gekommen und jetzt gestandene Bundesliga-Spieler sind, dass sich alle verbessert haben.
Was haben Sie von ihm gelernt?
Noch mehr auf Details zu achten, wie man Situationen ausspielt, worüber ich mir vorher nicht so viele Gedanken gemacht habe. Einfach analytischer ranzugehen. Und dass ich noch mehr machen muss, wie Papa gesagt hat.

Was Sie ja neuerdings auch noch machen: Klavier spielen.
Ich habe eins zu Hause, habe Unterricht genommen, bin aber seit dem Winterurlaub nicht mehr so in Stimmung.
Welches Stück haben Sie zuletzt geübt?
„All of me“ von John Legend.
Warum gerade Klavier?
Wunderschönes Instrument, auch für den Kopf richtig gut. Hätte auch Gitarre sein können. Mit Freunden zusammensitzen, fröhlich sein, bisschen Musik machen: Das find ich ganz nice.
So ein Mann am Klavier soll ja eine enorme Wirkung auf Frauen haben. Können Sie das bestätigen?
(Er grinst breit, steht auf, schlägt mit dem Fragesteller ein, setzt sich wieder) Trotz meines Anfängerstatus kann ich das bestätigen.
Möchten Sie ins Detail gehen?
Nein, das reicht schon. Aber ich tue es auch für mich, nicht nur für die Frauenwelt. Ich freue mich brutal, wenn ich besser werde, gerade was die Koordination betrifft. Macht richtig Spaß.
Außerdem machen Sie Yoga, lesen Bücher über gesunden Schlaf – wie sieht bei Ihnen ein total unvernünftiger Tag aus?
Feiern gehen ist ja nicht unvernünftig. Auf jeden Fall schlafe ich lang, esse mal viel Süßes – und sonst? Ein unvernünftiger Tag ist für mich vor allem, wenn ich nichts Produktives mache, nichts dazulerne.
Sie sind in den letzten Jahren sehr viel herumgekommen. Wo und mit wem fühlen Sie sich zu Hause?
Family first! Man vergisst nie, wo man herkommt. Weissach ist immer noch meine Base und wird das auch bleiben.
Woran erkennt man heute noch den Schwaben in Ihnen?
Ich spare gerne! Ich gebe allerdings auch gerne aus ... (lacht). Und sonst? Ich liebe die Käsespätzle von meiner Oma: Es gibt nichts Besseres!
Und wie viel Elfenbeinküste steckt in Ihnen?
Hälfte, klar.
Waren Sie schon mal dort?
Zweimal, in diesem Sommer möchte ich wieder hin für zwei, drei Wochen. Ich habe viel Familie dort. Es ist immer wieder gut, diese andere Welt zu sehen. Die Leute dort haben ganz andere Probleme als wir hier und sind trotzdem happy. Das bringt einen total runter, man merkt wieder, was Sache ist, was es eigentlich braucht zum Leben. Es erdet einen brutal. Kann ich nur jedem raten, mal so eine Erfahrung zu machen.